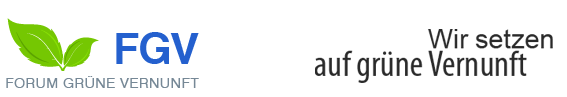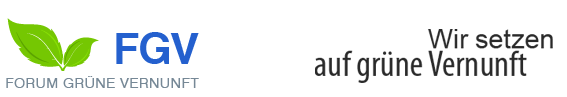Grüne Gentechnik: Warum wir uns das Gut-böse-Schema in der Agrarforschung immer weniger leisten können.
Die Gentechnik bei Nutzpflanzen – die sogenannt grüne Gentechnologie – ist in der Schweiz und in Europa völlig out, und das finden viele sogar gut so. Leider ist diese Haltung für die ärmsten Entwicklungsländer problematisch, wie die Geschichte Afrikas zeigt. Gut gemeinte Ratschläge aus Europa haben dazu geführt, dass Afrika der Kontinent mit der grössten Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten ist. Und viele Entwicklungsexperten glauben heute noch, dass Unternehmertum und neue Technologien wie die Biotechnologie bei Nutzpflanzen «westliche Konstrukte» seien, die den Entwicklungsländern aufgezwungen würden.
Das Gegenteil ist der Fall: Erfahrungen in erfolgreichen Schwellenländern in Asien und Lateinamerika haben gezeigt, dass die Nutzung neuer Technologien ein wirtschaftliches Wachstum aus eigener Kraft ermöglicht, wenn sie von Investitionen in praxisorientierte Bildung und Forschung begleitet ist. Das hat auch zur politischen und wirtschaftlichen Emanzipation breiter Bevölkerungsschichten beigetragen.
Der einzige Kontinent, der keine grüne Revolution erlebt hat, ist Afrika. Der Schwarze Kontinent ist auch kaum in die moderne Wissensökonomie integriert und konnte trotz massiver Auslandhilfe keine wesentlichen Verbesserungen in der nachhaltigen Entwicklung erzielen. Und dieses Scheitern hat nicht nur mit Afrika selbst zu tun, sondern auch mit seiner Abhängigkeit von Europas Konsumpräferenzen und Entwicklungsvorstellungen. Biozertifizierte Produkte aus Afrika zum Beispiel sind mittlerweile zu einem kapitalintensiven Geschäft geworden, das hauptsächlich von Europäern für Europäer gemanagt wird.
Vorteile der Gentechnologie
Europas Dominanz als Geldgeber und Produktabnehmer Afrikas wird jedoch immer mehr von wachsenden Süd-Süd-Investitionen abgelöst. Handel und Austausch zwischen Afrika und anderen Schwellenländern wie China oder Brasilien nehmen stetig zu, während Europas Einfluss abnimmt. Der Süd-Süd-Ansatz besticht durch Experimentierfreude und Pragmatismus, und die grüne Gentechnik wird dabei nicht a priori ausgeschlossen. Vieles deutet darauf hin, dass die Afrikaner diese Art der Zusammenarbeit bevorzugen; denn sie ist weniger bevormundend, und die Resultate versprechen mehr, auch wenn beim Ausprobieren von Neuem immer wieder Fehler passieren.
Wieso setzen Länder wie Brasilien und China in der öffentlichen Agrarforschung auch auf die Gentechnik? Weil diese Technologie in manchen Bereichen Vorteile gegenüber der traditionellen Züchtung hat und es unverantwortlich wäre, ihr Potenzial zu ignorieren. Denn der Klimawandel und die Ernährungskrise treffen vor allem die Bevölkerung in Entwicklungsländern. Deren Regierungen können es sich nicht mehr leisten, nur auf Bewährtes und Traditionelles zu setzen. Kommt hinzu, dass auch die grüne Gentechnik sehr wohl auf lokale Bedürfnisse von Kleinbauern angepasst und mit traditionellen Praktiken kombiniert werden kann.
Sie hat den Vorteil, dass bestimmte Eigenschaften wie Virusresistenz direkt in eine lokale Pflanzensorte eingesetzt werden können, ohne den bevorzugten Geschmack oder die agronomischen Qualitäten zu verändern, etwa den Ertrag oder die Lagerfähigkeit. Ende der 90er-Jahre etwa konnte mithilfe der Gentechnik die Papayaernte in Hawaii vor einem massiven Virusbefall gerettet werden. Die virusresistente Gentechpapaya wird nun schon seit über zehn Jahren angebaut und konsumiert.
Eine Erfolgsgeschichte, die in Fachkreisen mit Interesse verfolgt wird. Dazu gehören internationale Agrarforschungsnetzwerke (crop research networks) zur Verbesserung wichtiger Nutzpflanzen. Diese Netzwerke sind entstanden, als europäische Staaten in den 90er-Jahren im Sog der Gentechkritik die Finanzierung der öffentlichen Agrarforschung massiv kürzten.
Heute werden diese Zusammenschlüsse von Forschern, Bauernorganisationen und ländlichen Unternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern getragen, wo das Interesse an der Verbesserung wichtiger Nutzpflanzen nach wie vor gross ist. Oft sind das Partnerschaften zwischen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen. Weil darin Vertreter der südlichen Länder das Sagen haben, werden auch die kosteneffektivsten Lösungen gesucht, die aus einer Kombination von erfolgreichen agrarökologischen Praktiken und modernen Züchtungstechniken bestehen.
Problematische Agroindustrie
Erfolgreiche Beispiele wie die virusresistente Papaya passen jedoch nicht ins reduktionistische Schwarzweisskonzept, nach dem Gentech prinzipiell böse und Bio gut ist. Die Konzentration in der Agroindustrie auf wenige mächtige Unternehmen ist sicherlich ein Problem. Leider verstärken die Gegner der Gentechnik mit ihrer Forderung nach immer mehr Regulierung diese Konzentration zusätzlich. Denn davon am meisten betroffen sind ausgerechnet internationale Agrarforschungsnetzwerke und kleine innovative Unternehmen, die Lösungen suchen, die am besten an die drängenden Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung in den Entwicklungsländern angepasst sind.
Philipp Aerni, Agrarökonom
Wissen und Technologie für Afrika
Ob die Gentechforschung bei Nutzpflanzen einen Beitrag zur Ernährungssicherheit und zur Lösung von Umweltproblemen in Entwicklungsländern
leisten kann, ist umstritten. Vor zwei Wochen sprach sich Kumi Naidu, Chef von Greenpeace International, prinzipiell gegen Gentech-Pflanzen in
Entwicklungsländern aus (TA vom 17. 12.). Der Schweizer Geograf und ETH-Agrarökonom Philipp Aerni glaubt jedoch, dass diese Teil einer Gesamtstrategie sein könnten. Aerni ist Mitbegründer des African Technology Development Forum (www.atdforum.org) in Genf. Hauptziel ist die Förderung von Wissenschaft, Technologie und Unternehmertum in Afrika. Seit 2007 ist Aerni zudem am World Trade Institute der Uni Bern tätig und unterrichtet an der ETH Zürich «Science, Technology and Public Policy». (mma)